Vorratsdaten helfen nicht bei Kriminalitätsbekämpfung
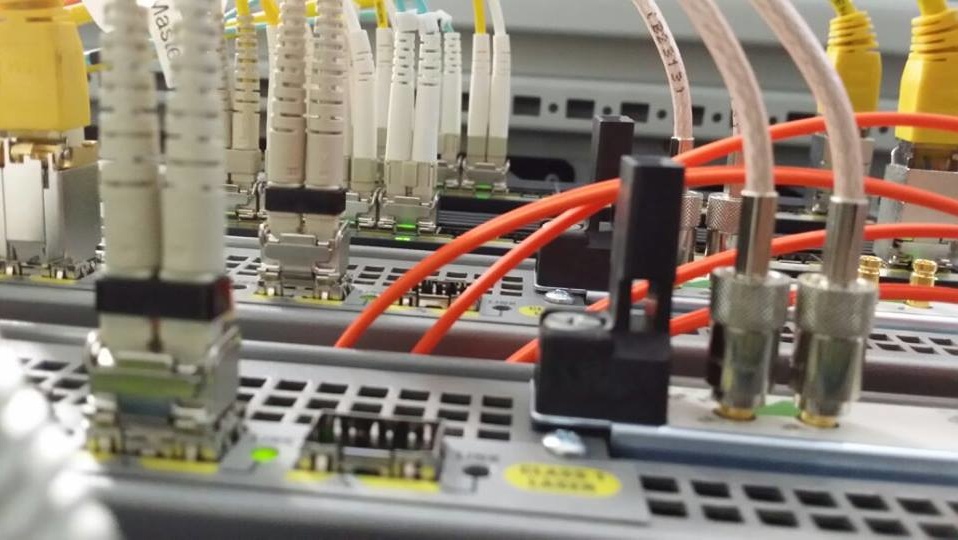
Eine neue Studie vom Max-Planck-Institut erhebt deutliche Zweifel am Nutzen der Vorratsdatenspeicherung. Nach Ansicht der Forscher bestehe keine „Schutzlücke“ ohne die Verfügbarkeit von Vorratsdaten, wie von Vertretern der Ermittlungsbehörden und Sicherheitspolitikern wiederholt behauptet wurde.
Die Vorratsdatenspeicherung könne keine Bewegungen in den Aufklärungsquoten erklären, stellen die Forscher der kriminologischen Abteilung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in einem Gutachten fest. Selbst im Bereich Computer- und Internetkriminalität könne nicht nachgewiesen werden, dass anlasslose Speicherung von Vorratsdaten die Aufklärungsraten beeinflusse. Auch ein Vergleich mit Österreich und der Schweiz lässt keine Rückschlüsse auf eine positive Wirkung der Vorratsdatenspeicherung zu. In der Schweiz wird die Vorratsdatenspeicherung bereits seit zehn Jahren praktiziert, Hinweise auf eine systematisch höhere Aufklärung fehlen.
Allerdings basieren die aktuellen Ergebnisse noch auf einer unsicheren statistischen Datengrundlage. Es fehlen systematische Untersuchungen, Einschätzungen innerhalb der Ermittlungsbehörden fallen unterschiedlich aus. Verbesserte wissenschaftlichen Evaluationen sind innerhalb der Ermittlungsbehörden aus Kostengründen auch für die Zukunft nicht geplant, weswegen als Nachweis für die generelle Notwendigkeit der anlasslosen Datenspeicherung die Bewertung über Einzelfälle erfolgt. In einzelnen Fällen sind Ermittlungserfolge auch von Vorratsdaten abhängig, Auswirkungen auf die Aufklärungsquote haben diese aber offenbar nicht.
Ebenso lassen sich keine Hinweise finden, dass Schutzfunktionen durch den Wegfall der Vorratsdatenspeicherung leiden würden. Ein oft genanntes Argument für die Vorratsdatenspeicherung ist der Kampf gegen Kinderpornographie, jedoch führen Ermittlungen gegen Kinderpornographie allenfalls zufällig zur Aufklärung in Fällen von sexuellen Missbrauch. In Folge dessen fordern die Forscher, die vorhandenen Ressourcen besser in Präventionsmaßnahmen und die Repression von Kindesmissbrauch zu investieren.
Bei der Verhinderung von Terroranschlägen scheinen Vorratsdaten keine Hilfestellung zu geben, auch wenn das vehement von Ermittlungsbehörden und Sicherheitspolitikern verlautbart wird. In den letzten zehn Jahren habe es keine Hinweise gegeben, dass Mittels Vorratsdaten ein Anschlag verhindert werden konnte. Ein Nutzen für Ermittlungen bestehe bestenfalls nach einem Anschlag. Allerdings stelle sich dann oft die Frage, warum potentiell vorhandene Daten nicht genutzt wurden, um einen Anschlag zu verhindern.
Potentielle Schutzlücken durch fehlende Vorratsdaten existieren dennoch, lassen sich aber nicht anhand spezieller Straftaten oder an Bereiche festmachen. Entscheidenden Einfluss haben neben der Deliktsart die konkrete Ermittlungssituation, der Zeitpunkt, die benötigten Daten und der zuständige Telekommunikationsanbieter/Provider. Diese speichern ohnehin Verkehrsdaten, zum Beispiel zu Rechnungszwecken, auf die Ermittlungsbehörden zugreifen könnten. Allerdings ist die Speicherdauer von Verkehrsdaten aktuell gesetzlich nicht fest geregelt, was die Ermittler vor Probleme stellt. Ein weiterer Schwachpunkt der Vorratsdatenspeicherung liegt bei Handys mit Prepaid-Karten aufgrund der unzureichenden Identifizierung der Nutzer.
Fertiggestellt wurde die Studie (PDF: Vollständig; Kurzfassung) bereits im Juli 2011 im Auftrag des Justizministeriums, wurde bislang aber zurückgehalten. Nachdem erste Passagen in den letzten Tagen publik wurden, ist die vollständige Studie nun vom Chaos Computer Club (CCC) veröffentlicht worden. „Die umfangreiche europaweite Erhebung und Auswertung des MPI offenbart, dass die Stammtischparolen von der Schutzlücke durch den Wegfall der anlasslosen Telekommunikationsdatenspeicherung keine Faktenbasis haben“, erklärte CCC-Sprecher Frank Rieger.
Verantwortliche Ministerien streiten munter weiter
Studie hin oder her, der Streit zwischen dem Innen- und Justizministerium setzt sich unvermittelt fort. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) lässt sich von den Ergebnissen des Max-Planck-Instituts nicht beeindrucken. „Die Studie hat für uns keinerlei Relevanz“, sagte Friedrichs Sprecher Jens Teschke. Nur mit der Vorratsdatenspeicherung könne man die „Strukturen organisierter terroristischer und krimineller Netzwerke“ aufdecken, die Studie basiere auf einer „unsicheren empirischen Faktenbasis“.
Das sieht man im Justizministerium gänzlich anders, das Max-Planck-Institut bestätige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) in ihrem Widerstand gegen eine erneute Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung nach den Vorgaben der umstrittenen EU-Richtlinie. „Der Bürger, der nichts zu verbergen hat, weil er unschuldig ist, der darf nicht überwacht und kontrolliert werden“, sagte die Ministerin. Justizstaatssekretär Dr. Max Stadler sagte, die Notwendigkeit sei empirisch nicht belegt, sondern nur ein Gefühl der Ermittlungsbehörden. Dort verweise man auf Einzelfälle, die dann als „typisch“ dargestellt werden, obwohl solche „Behauptungen aber weder belegt noch belegbar“ seien.
Im Justizministerium wirbt man weiterhin für das Quick-Freeze-Verfahren. Das erhält gemäß der Studie aber auch keine positive Resonanz von den Ermittlungsbehörden, da „lediglich ohnehin vorhandene Verkehrsdaten selektiv vor der Löschung“ bewahrt werden. Auf ältere Daten könne man aber nicht mehr zugreifen.
Das ursprüngliche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung trat am 1. Januar 2008 in Kraft, wurde aber am 2. März 2010 vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Für eine Neuregelung forderten die Richter die Einhaltung hoher Hürden. Seit Bestehen der schwarz-gelben Koalition ist die Vorratsdatenspeicherung eines der zentralen Streitthemen, angetrieben von der EU-Kommission, die mit Nachdruck eine erneute Umsetzung verlangt. Eine Einigung innerhalb der Koalition ist auf absehbarer Zeit nicht zu erwarten, sowohl FDP als auch die Union verharren auf ihren Standpunkten.
Mit Dank an addicT* für den Hinweis zu dieser News.
