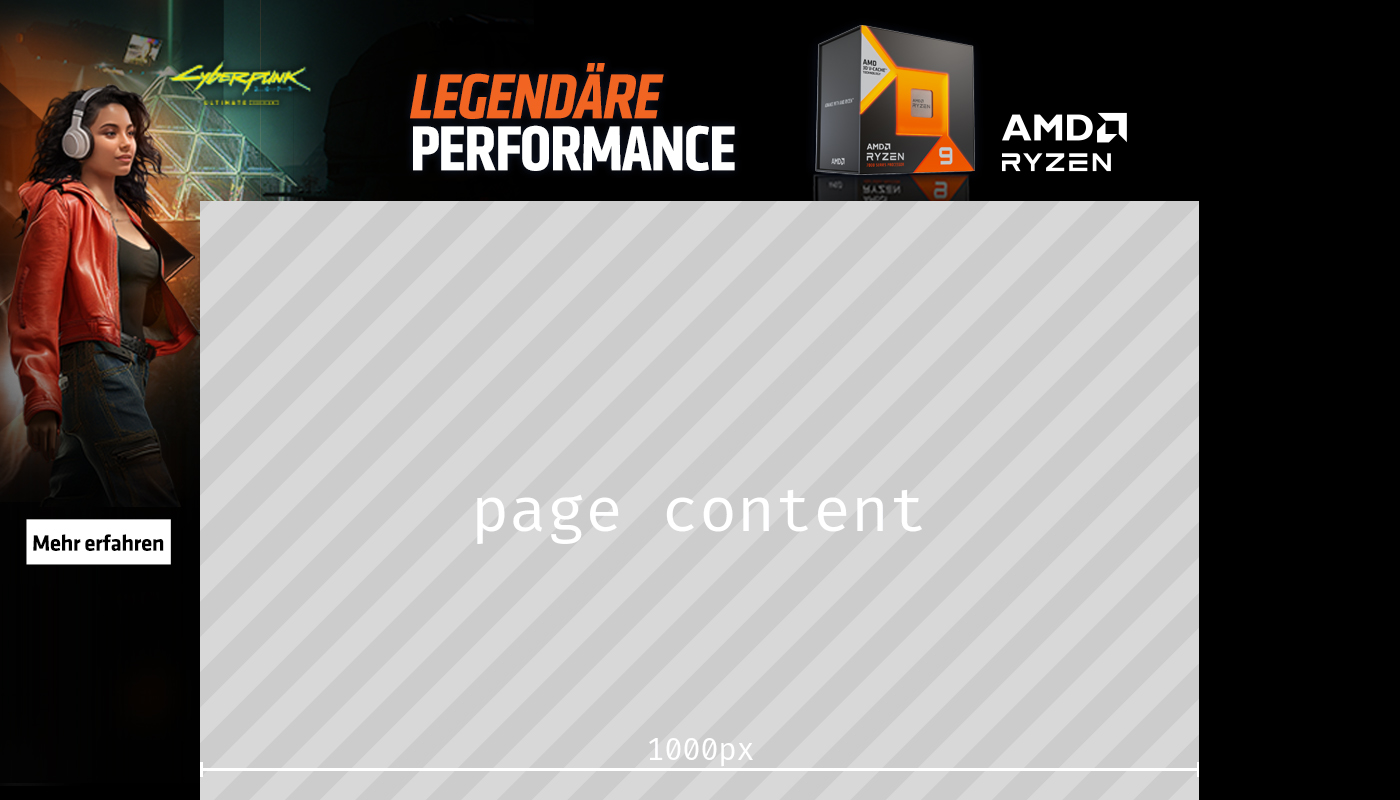Bundesverfassungsgericht: Vorratsdatenspeicherung bleibt vorerst bestehen

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Auf die Schnelle wird die Vorratsdatenspeicherung nicht gestoppt. Ein Eilantrag des SPD-nahen Netzpolitikvereins D64 wurde abgelehnt, da selbst das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nichts an der aktuellen Lage geändert habe.
Einen ersten Eilantrag lehnte das Bundesverfassungsgericht bereits im Sommer 2016 ab. Damals erklärten die Richter, die „umfassende und anlasslose Bevorratung sensibler Daten über praktisch jedermann [kann] einen erheblichen Einschüchterungseffekt bewirken, weil das Gefühl entsteht, ständig überwacht zu werden“, doch die Konsequenzen wären nicht so gravierend, dass das Gesetz sofort außer Kraft gesetzt werden müsste.
Zweiter Eilantrag abgelehnt
Den zweiten Eilantrag begründet der D64 nun mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Dezember 2016. An der Haltung des Bundesverfassungsgerichts hat sich damit aber nichts geändert. Auch nach der EuGH-Entscheidung „stellen sich hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Bewertung der angegriffenen Regelungen Fragen, die nicht zur Klärung im Eilrechtschutzverfahren geeignet sind“, heißt es in der Mitteilung, die heute veröffentlicht wurde.
Über ein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung sagt das noch nichts aus, im Prinzip ist es nur eine Verfahrensfrage. Daher bleibt der D64 auch zuversichtlich. Auf Anfrage von Netzpolitik.org erklärte Nico Lumma, Co-Vorsitzender beim D64 und Beschwerdeführer bei diesem Eilantrag: „Die Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig.“ Gespannt warte man nun auf die endgültige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die „hoffentlich noch in diesem Jahr kommt“, so Lumma.
EuGH-Urteil bestätigte Kritiker
Als der Europäische Gerichtshof im Dezember 2016 entschied, dass eine anlasslose und verdachtsunabhängige Datenspeicherung nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist, hat sich das Blatt in der Debatte um die Vorratsdatenspeicherung endgültig gewandelt. Denn seitdem steht im Prinzip fest: Wenn Behörden die Verkehrs- und Verbindungsdaten sammeln wollen, darf das nicht massenhaft geschehen, sondern nur innerhalb bestimmter Vorgaben. So muss es etwa Grenzen für die erfassten Kommunikationsmittel, die betroffenen Personen oder die Speicherdauer geben.
Da das dem Konzept der Vorratsdatenspeicherung im Kern widerspricht, können sich Juristen nicht vorstellen, wie die deutsche Regelung vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen soll. Nötig wären vielmehr Alternativen wie das Quick-Freez-Verfahren.
Offiziell erfolgt der Startschuss für die deutsche Vorratsdatenspeicherung ohnehin erst im Sommer. Beschlossen wurde das Gesetz zwar schon im Dezember 2015, die Provider haben allerdings bis zum Juli 2017 Zeit, um die benötigte Infrastruktur aufzubauen. Geldverschwendung, sagen nun Wirtschaftsverbände wie der eco, der schon im Dezember ein Moratorium forderte, um Provider vor Investitionen zu bewahren, die bereits nach wenigen Monaten hinfällig sein könnten.