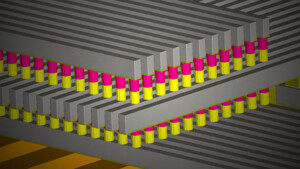keshkau
Commodore
- Registriert
- März 2007
- Beiträge
- 4.399
Zunächst einmal gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen, die eine globalisierte Wirtschaft für alle Beteiligten mit sich bringt. Da wäre zum einen die Internationalisierung, die von den einzelnen Staaten ausgeht. Sie führt dazu, dass Rohstoffe, Produkte, Dienstleistungen, Arbeit und Kapital grenzüberschreitend ausgetauscht werden. Zur Unterstützung dieses Austauschs entstand nach dem 2. Weltkrieg das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), das in mehreren Verhandlungsrunden zu spürbaren Zollsenkungen führte. In den letzten 40 Jahren wurden in drei mehrjährigen Runden durchschnittliche Zollsenkungen in Höhe von 36 %, 34 % und 40 % erzielt. Heute profitieren wir in Deutschland vom EU-Binnenmarkt, während zwischen den USA und Kanada das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) gilt.
Der zweite Aspekt ist die Multinationalisierung (= Transnationalisierung), bei der Unternehmen sowohl Kapital als auch Arbeit zwischen den Volkswirtschaften transferieren. Die Ziele für die Verlagerungen von Produktions- und Vertriebsstandorten sind meist Kosteneinsparungen und die Erschließung neuer Märkte. So gesehen kann man kritisieren, dass VW ein Werk in Shanghai gebaut hat. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es dabei um die Bedienung eines neu zu erschließenden Marktes ging.
Man kann die Globalisierung als das Bestreben der Staaten verstehen, die internationalen Zoll- und Handelsschranken zu deregulieren und zu liberalisieren. In der Folge nimmt der Einfluss der Staaten ab, während die Marktkräfte an Macht gewinnen. Wenn sich die Wirtschaft internationalisiert, muss die Politik das ebenso machen. Daher ist es zwingend, in einem vereinigten Europa mehr Kompetenzen aus den Nationalstaaten abzuziehen, weil viele Problemlösungen dort gar nicht länger als Insellösungen greifen können.
Als dritten Vorteil der Globalisierung kann man den Anstieg des Lebensstandards (zumindest in den Industrienationen) nennen, ebenso die Entstehung von Arbeitsplätzen, die der erzwungene und beschleunigte Strukturwandel mit sich bringt. Wenn die Entwicklungsländer in die Globalisierung einbezogen werden (z. B. durch die Abschaffung von Schutzzöllen), eröffnen sich ihnen ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten, die sie ohne die Globalisierung in dieser Form nicht hätten. Schließlich ist mit einer zunehmenden Demokratisierung im Zuge der Globalisierung zu rechnen. Das Beispiel China wurde bereits genannt, aber auch in Afrika ist vorstellbar, dass man die Teilnahmemöglichkeit am Welthandel von der politischen und rechtlichen Situation in einem Land abhängig macht.
Die Globalisierung führt auch dazu, dass international tätige Unternehmen stärker von NGOs überwacht werden. Organisationen wie Greenpeace, WWF, Amnesty International oder Human Rights Watch verfügen über ein weltweites Kommunikations- und Informationsnetz und nehmen die Aktivitäten der Konzerne immer genauer unter die Lupe.
Die Globalisierung wirkt sich auch auf die Anspruchsgruppen aus, mit denen die Unternehmen zu tun haben. Die Aktionäre drängen darauf, Unternehmensbereiche mit niedriger Ertragskraft zu schließen oder abzustoßen, um die Rendite zu verbessern. Im Fokus stehen dabei Kostensenkungen, der Abbau freiwilliger sozialer Leistungen und Produktivitätssteigerungen.
Aber auch die Beschäftigten fordern ihren Tribut. Sie verlangen nach einem betrieblichen Vorschlagswesen, um selbst Potenziale zur Effizenzsteigerung benennen zu können. Weiterhin nutzen sie die Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung (Zeitkorridore, Gleitzeit) und Leistungsanreize in Form von Leistungsbewertungen und Erfolgsbeteiligungen. Neue Arbeitsformen wie Telearbeit oder Heimarbeit stehen ebenso auf der Forderungsliste wie die Altersteilzeit oder in Deutschland die Krippenplätze oder der Betriebssport. In diesen Punkten müssen die Unternehmen den (gut ausgebildeten) Beschäftigten entgegenkommen.
Der zweite Aspekt ist die Multinationalisierung (= Transnationalisierung), bei der Unternehmen sowohl Kapital als auch Arbeit zwischen den Volkswirtschaften transferieren. Die Ziele für die Verlagerungen von Produktions- und Vertriebsstandorten sind meist Kosteneinsparungen und die Erschließung neuer Märkte. So gesehen kann man kritisieren, dass VW ein Werk in Shanghai gebaut hat. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es dabei um die Bedienung eines neu zu erschließenden Marktes ging.
Man kann die Globalisierung als das Bestreben der Staaten verstehen, die internationalen Zoll- und Handelsschranken zu deregulieren und zu liberalisieren. In der Folge nimmt der Einfluss der Staaten ab, während die Marktkräfte an Macht gewinnen. Wenn sich die Wirtschaft internationalisiert, muss die Politik das ebenso machen. Daher ist es zwingend, in einem vereinigten Europa mehr Kompetenzen aus den Nationalstaaten abzuziehen, weil viele Problemlösungen dort gar nicht länger als Insellösungen greifen können.
Als dritten Vorteil der Globalisierung kann man den Anstieg des Lebensstandards (zumindest in den Industrienationen) nennen, ebenso die Entstehung von Arbeitsplätzen, die der erzwungene und beschleunigte Strukturwandel mit sich bringt. Wenn die Entwicklungsländer in die Globalisierung einbezogen werden (z. B. durch die Abschaffung von Schutzzöllen), eröffnen sich ihnen ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten, die sie ohne die Globalisierung in dieser Form nicht hätten. Schließlich ist mit einer zunehmenden Demokratisierung im Zuge der Globalisierung zu rechnen. Das Beispiel China wurde bereits genannt, aber auch in Afrika ist vorstellbar, dass man die Teilnahmemöglichkeit am Welthandel von der politischen und rechtlichen Situation in einem Land abhängig macht.
Die Globalisierung führt auch dazu, dass international tätige Unternehmen stärker von NGOs überwacht werden. Organisationen wie Greenpeace, WWF, Amnesty International oder Human Rights Watch verfügen über ein weltweites Kommunikations- und Informationsnetz und nehmen die Aktivitäten der Konzerne immer genauer unter die Lupe.
Die Globalisierung wirkt sich auch auf die Anspruchsgruppen aus, mit denen die Unternehmen zu tun haben. Die Aktionäre drängen darauf, Unternehmensbereiche mit niedriger Ertragskraft zu schließen oder abzustoßen, um die Rendite zu verbessern. Im Fokus stehen dabei Kostensenkungen, der Abbau freiwilliger sozialer Leistungen und Produktivitätssteigerungen.
Aber auch die Beschäftigten fordern ihren Tribut. Sie verlangen nach einem betrieblichen Vorschlagswesen, um selbst Potenziale zur Effizenzsteigerung benennen zu können. Weiterhin nutzen sie die Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung (Zeitkorridore, Gleitzeit) und Leistungsanreize in Form von Leistungsbewertungen und Erfolgsbeteiligungen. Neue Arbeitsformen wie Telearbeit oder Heimarbeit stehen ebenso auf der Forderungsliste wie die Altersteilzeit oder in Deutschland die Krippenplätze oder der Betriebssport. In diesen Punkten müssen die Unternehmen den (gut ausgebildeten) Beschäftigten entgegenkommen.