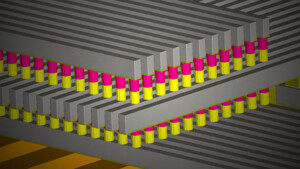SheepShaver schrieb:
Ich finde es immer wieder belustigend, wie einige Leute sich hier groß aufspielen und die Hilfsmaßnahmen sozusagen als ein Kinderspiel darstellen.
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,372996,00.html
ÜBERLEBEN AN DER TODESKÜSTE
Entwurzelte Menschen, vernichtete Existenzen
Aus Tillmans Corner berichtet Marc Pitzke
Für Zehntausende an der US-Golfküste beginnt das wirkliche Elend erst jetzt: Obdachlos, arbeitslos und verarmt treiben sie einer ungewissen Zukunft entgegen. Verzweifelt kritisieren sie die Hilfsmaßnahmen, die nur schleppend anlaufen.
Brian Mulherin leitet, was er die "Operation Küche" nennt. 35 Rotkreuz-Hilfskräfte kommandiert er, drei große Gefriertrucks. Um ihn stapeln sich Hunderte Kisten mit Lebensmitteln und Wasserflaschen, Dutzende mobiler Öfen, sogar eine richtige Spülstation. An faltbaren Gestellen hängen Topflappen und Rollen mit Küchenpapier. Es riecht nach Hühnchen mit Reis und Pilzen - das Tagesgericht. "Schmeckt toll", sagt Mulherin, ein jovialer Rotkreuz-Mitarbeiter aus Florida.
Mulherins Feldküche steht hinter der First Baptist Church in Tillmans Corner, südwestlich von Mobile im US-Bundesstaat Alabama, nahe der Grenze zum verwüsteten Mississippi. "Katrina" ist hier vorbei geschrammt, Tillmans Corner ist glimpflich davon gekommen, der Flecken liegt auf einem Hügel. Ein paar Meilen weiter haben die Häuser keine Dächer mehr, die Hölle beginnt. Für die Tausenden Heimatlosen, die aus Mississippi flüchten, ist Tillmans Corner die erste Zivilisation, und Mulherins Feldküche ist ihre erste Anlaufstelle.
Aus vielen Bundesstaaten sind seine Helfer angereist, alle unbezahlte Freiwillige des Roten Kreuzes - Privatleute, die sich lange vor den staatlichen Truppen auf den Weg gemacht haben. Seit zwei Tagen teilen sie Mahlzeiten aus, gestern Spaghetti, heute Hühnchen, und hören erst auf, wenn die nächtliche Ausgangssperre kommt, die für das gesamte Notstandsgebiet gilt. 8000 Bedürftige sind hier schon gewesen, so viele andere stecken noch hilflos in der Katastrophenzone, ohne Sprit, Strom, Geld, Wasser und eine Chance, Hilfe zu erreichen.
"Dies ist ein Kriegseinsatz"
"Wir sind in der Lage, täglich bis zu 10.000 Menschen zu versorgen", sagt Mulherin. "Doch das wird nicht ausreichen." Die Katastrophe hat erst begonnen: Hunderttausende Obdachlose in drei Staaten, entwurzelte Menschen, vernichtete Existenzen, zerstörte Lebensläufe. Allein im Örtchen Bayou la Batre in Alabama verloren 2000 Menschen ihr Heim.
"Dies ist ein Kriegseinsatz", sagt Mulherins Rotkreuz-Kollege Phil St. Laurent, der das Flüchtlingsasyl managt, zu dem die Turnhalle des Gemeindehauses umgebaut ist: Feldbetten, eine Fernsehecke für die Kinder, ein Tisch mit Limonade und Eistee - eines von 284 Auffanglagern, die das Rote Kreuz eingerichtet hat. "Wir behandeln dies wie einen Krieg. Wir wollen den Leuten helfen, einen Übergang zum Nachkriegsleben zu finden."
Denn auch für die ist es ein Kriegserlebnis - ob im Chaos von New Orleans oder in Mobile am Rande der Zerstörungsschneise. Vielen wird das erst jetzt bewusst, da der erste Schock der Realität weicht. Zwischen beiden Orten ist an der Golfküste die gesamte Infrastruktur des Alltags zerstört: Keine Jobs, kein Geld, keine Nahrung, Seuchengefahr.
"Wasser", sagt Thelma Weingarten. "Habt ihr Wasser?" Sie sitzt am Steuer eines alten Fords, hinten ihre Tochter, und hat sich von Gulfport aus durchgeschlagen, einem weggeschwemmten Ort in Mississippi. Tillmans Corner ist ihre erste Hoffnung, und ihre letzte. "Wir haben gehört, dass es hier Sprit gibt. In Gulfport gibt es nichts mehr. Man hat uns verlassen. Wo ist die Regierung?"
Willie Hill ist ebenfalls wegen Sprit und Wasser aus Pass Christian gekommen, das noch weiter weg ist. "Alles ist weg", sagt der Mann. "Wir haben kein Leben mehr. Aber wir haben einander. Die Sonne wird wieder scheinen."
Schwarze und Arme als Hauptopfer?
Um die Versorgungs-Maschinerie wenigstens halbwegs zum Laufen zu bringen, hat sich am Civic Center von Mobile die US-Nationalgarde postiert - und auch die wird nicht von Washington befehligt, sondern von den Bundesstaaten. Sergeant First Class John Strong aus Minnesota und 16 seiner Männer, flankiert von einer Handvoll Zivilisten, rackern zwölf Stunden pro Tag in der Hitze. Ihre Mission: Trinkwasser und Eis.
Vierspurig stehen die Leute mit ihren Autos und Trucks an, zu Tausenden, ums ganze Civic Center herum. Auf der anderen Seite laden die Helfer neun riesige Kühl-Lkws aus, fünf mit Wasser, vier mit Eis, und verteilen die Ware. Ein bezeichnendes Bild: Die Helfer sind alle weiß, die Bedürftigen ausnahmslos Schwarze.
Das ist mittlerweile auch den Politikern in Washington aufgefallen: Eine Gruppe schwarzer Kongressabgeordneter wirft der US-Regierung vor, die Notleidenden vor allem in New Orleans so lange vernachlässigt zu haben, weil sie Schwarze und Arme seien. Der Demokrat Elijah Cummings nennt den "Unterschied zwischen Leben und Tod" eine Frage "von Klasse, Rasse und Hautfarbe". Es sei eine "Schande für die großartigste Demokratie der Welt, dass sie so was zulässt", sagt die Abgeordnete Stephanie Tubbs Jones.
Stundenlanges Ausharren für ein paar Liter Benzin
Erst am gestrigen Freitag stattet Präsident George W. Bush dem Katastrophengebiet eine Kurzvisite ab. Zuvor hatte er erklärt, er freue sich schon darauf, bald auf der wieder aufgebauten Veranda seines Parteifreunds Trent Lott zu sitzen, dessen Haus in Pascagoula vom Hurrikan zerstört wurde. Dass Lott sein Amt als Top-Republikaner im Senat ausgerechnet über rassistische Äußerungen verloren hat, schien Bush entfallen zu sein.
Sergeant Strong hat derweil andere Sorgen. "Desaster- und Katastrophenhilfe", sagt er. "Das ist unsere eigentliche Mission. Nicht der Irak." Der Gardist, Sonnenbrille im Gesicht, scheut keine Worte: "40 Prozent unserer Leute sind im Irak. Wir sind bis auf den letzten Mann gestreckt." Wann er denn das letzte Mal einen Einsatz dieser Dimension gefahren habe? "Im Irak. Doch das hier ist unsere größte Mission." Und dann sagt er dasselbe, das auch Rotkreuz-Helfer Mulherin sagt: "Es ist ein Kriegseinsatz."
Kriegszustände auch anderswo. Die plötzliche Benzinknappheit in der Region führt zu grotesken Auswüchsen. In Mississippi und Louisiana gibt es fast nichts, in Alabama nur Tropfen. Die Regierung ruft zum Rationieren auf, viele Tankwarte verlangen dagegen mindestens 30 Dollar pro Fahrer. In Mobile harren die Leute stundenlang vor den abgesperrten Tankstellen aus - nur auf das Gerücht hin, dass es Sprit geben könnte.
Die Exxon-Tankstelle am Highway 98 öffnet für eine Stunde. Polizisten sorgen dafür, dass sich die Fahrer nicht prügeln. Das Gerücht macht die Runde, in einem Nachbarort habe sich einer den Sprit mit Waffengewalt erkämpft. Die Justiz gibt einen Erlass heraus, wonach Benzinraub fortan als Schwerverbrechen gilt, mit einer Strafandrohung von 10 bis 15 Jahren Haft.
Banges Fragen nach der Zukunft
Über 725.000 Menschen sind am Freitag noch ohne Elektrizität. Ohne Kühlschränke, ohne Klimaanlage, ohne Ventilation, ohne Licht, viele auf Wochen hinaus. Doch bei 40 Grad im Schatten und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit wird Strom buchstäblich zur Frage von Leben und Tod, nicht nur in Altersheimen und Kliniken.
Nach Zerstörung und Vertreibung kommen die bangen Fragen nach der Zukunft: Wie lässt sich in dem Chaos auch nur "der Anschein von Normalität wiederherstellen", wie es Bob Riley formuliert, der Gouverneur von Alabama. Ganz zu schweigen davon, so Gesundheitsminister Mike Leavitt, "das Leben zu rekonstruieren".
Die Aufgabe ist gigantisch: Gehaltsschecks bleiben aus, Konten sind verschwunden, Banken zerstört, Geldautomaten außer Betrieb. Die staatliche Flutversicherung zahlt nur 250.000 Dollar für ein verlorenes Haus, plus 100.000 Dollar für dessen Inhalt. Doch erst mal muss ein ordentlicher Antrag gestellt werden. Und dazu braucht man ein funktionierendes Telefon - oder ein Auto mit Sprit. Das Geld der US-Katastrophenbehörde Fema, soweiso nur auf Pump, kommt erst nach 30 Tagen Wartefrist.
Experten rechnen damit, dass die Arbeitslosenquote an der ganzen US-Golfküste auf 20 Prozent ansteigen dürfte. "Die wirtschaftlichen Folgen hier unten", sagt Nationalgardist Strong, "werden die nach 9/11 weit übersteigen."
Doch vorerst geht es um das schlichte Überleben: Wasser, Essen, Obdach. Rotkreuzler St. Laurent, sonst Pensionär, ist zum Helfen aus dem fernen Missouri hergekommen. Wie lange wird er bleiben? Da lacht er nur. "Wer weiß", sagt St. Laurent. "Wir rechnen mit mindestens mehreren Monaten."