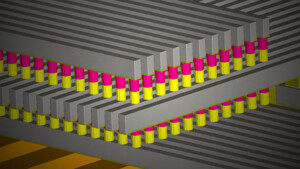Nachdem ich meine ersten spontanen Gedanken schon am Freitag geäußert habe, unternehme ich mal einen zweiten Anlauf zum Thema Arbeit und zu meiner Sicht der Dinge. Ich fange mal ganz früh an: Als Kind geht man zunächst einmal zur Schule und ich hoffe, dass dort noch keine Rede von Entfremdung ist. Irgendwann im Alter von ca. 14 bis 20 Jahren muss sich jeder Mensch allerdings doch Gedanken machen, wie er in den kommenden Jahrzehnten seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte. Bei einigen Glückspilzen, die dauernd beim Lotto gewinnen oder die eine Handvoll Millionen Euro in den Schoß gelegt bekommen, mag das kein großes Thema sein, für den Rest der Bevölkerung schon. Reich zu heiraten ist eine der Strategien, die manchmal verfolgt wird, doch die Mehrheit wird zu dem Schluss kommen, dass sie wohl oder übel arbeiten muss.
Nun kann man in Deutschland nicht einfach so in den Wald laufen und dort als Einsiedler leben, der von dem lebt, was er gesammelt oder gejagt hat. Das funktioniert auf Dauer nicht wirklich. Im Endeffekt hat man deshalb wohl keine andere Wahl als sich mit den Verhältnissen abzufinden, die man in seinem Umfeld konkret vorfindet. Wenn dieses Umfeld klein ist, sagen wir ein winziges Kaff irgendwo auf dem Land, dann werden die dortigen Entfaltungsmöglichkeiten vermutlich eher gering sein. Definiert man sein Umfeld größer, z. B. landesweit oder sogar weltweit, dann ergeben sich daraus jedoch unzählige Möglichkeiten.
Nun kann man sich fragen, ob die Verhältnisse, in denen man lebt (und die ich absichtlich nicht als System bezeichnet habe), einen Unterschied machen in Bezug auf die Arbeit. Ein Arbeiter, der in einem der als sozialistisch bezeichneten Länder dieser Erde lebt, bleibt meiner Meinung nach ebenso wenig Eigentümer der von ihm hergestellten Produkte wie sein Kollege in einer Marktwirtschaft, der dort für seine Arbeitszeit entlohnt wird. Das erwähne ich an dieser Stelle aber nur am Rande.
Zurück zu den Jugendlichen, die sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft macht: Da einem in Deutschland nichts vorgeschrieben wird und die Berufsfreiheit gilt, stehen einem grundsätzlich alle Türen offen. Dass es Einschränkungen hinsichtlich der Qualifikation gibt (vgl. Fahrlehrer, Ärzte, Richter usw.), sollte dabei kein Problem darstellen. Die Jugendlichen haben daher die freie Wahl. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt! Man entscheidet nicht nur darüber, an welchem Fließband man steht, sondern ob man überhaupt an einem Fließband steht. Wer sich beim Automobilbauer xy bewirbt und dort einen Arbeitsvertrag unterschreibt, kann sich anschließend schlecht über seinen Job beklagen. Er hat ihn sich schließlich eigenhändig ausgesucht und seine Arbeitnehmervertreter (in der Regel Gewerkschaften) haben in seinem Namen die wesentlichen Bedingungen verhandelt. Deshalb genügt es nicht, den Zeigefinger auf den Unternehmer zu richten. Man muss sich auch an die eigene Nase fassen, weil man selbst wesentlich dazu beigetragen hat, dass man diese Arbeit überhaupt macht.
Wenn ich jetzt an Marx denke, dann sehe ich bisher noch keinen Ansatzpunkt, um z. B. über die Entfremdung von der Arbeit zu sprechen. Also geht es erst einmal weiter. Der Jugendliche ist naturgemäß kein Selbstversorger, sondern Mitglied einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft, in der Güter und Dienstleistungen mit Hilfe von Geld getauscht werden. Er sollte sich daher überlegen, wie er an Geld kommt.
Was könnte er machen? Er könnte Bilder malen und verkaufen. Er könnte sich als Sänger versuchen oder als Händler von Waren. Er könnte Kinderspielzeug basteln oder alten Leuten beim Einkaufen helfen. Er könnte Schuhe putzen, Fenster reinigen, Software programmieren usw. Theoretisch ginge das alles – und noch viel mehr.
Es stellen sich allerdings Hindernisse in den Weg. Ohne das entsprechende Talent und ohne Ausbildung findet er keine Abnehmer für seine Bilder. Ohne das entsprechende Talent und ohne Ausbildung will niemand seinen Gesang hören. Für die Produktion seines Kinderspielzeugs braucht er zu lange, sodass er nicht auf die Stückzahlen kommt, die er zum Leben bräuchte. Außerdem ist sein Spielzeug aus Sicht der Kunden zu teuer. Für das Putzen von Schuhen gibt es keinen richtigen Markt und als Fensterputzer kommt er nicht gegen die etablierte Konkurrenz an. Als Programmierer hat er bisher nur wenig Erfahrungen gesammelt, sodass er keine Referenzen vorweisen kann. Die Aufträge bleiben aus. – Die Situation ist auch deshalb so trist, weil wir in Deutschland in einem technisch sehr fortschrittlichen Land leben. Viele unserer gängigen Produkte sind alles andere als simpel. Ihre Herstellung erfordert das Know-how zahlreicher Fachleute sowie nicht selten auch teures Equipment.
Der Fortschritt (Wohlstand) und die Arbeitsteilung gehen dabei Hand in Hand: Ohne die Arbeitsteilung hätten wir den derzeitigen Wohlstand nicht und die Aufrechterhaltung des Wohlstands erfordert weiterhin die Arbeitsteilung. Denn keine Einzelperson wäre in der Lage, ein Auto, einen PC oder ein Flugzeug zu bauen. Das klappt nur mit gemeinsamer Anstrengung.
Wenn jemand ein Problem mit dem Prinzip der Arbeitsteilung hat, dann muss er sich darüber klar werden, dass uns ein Verzicht darauf zurück in die Steinzeit führen würde. Und ich bezweifele, dass es den Menschen damals besser gegangen ist (medizinische Versorgung, Nahrungsangebot, ein Dach über dem Kopf usw.)
Zurück zu dem Jugendlichen, der Geld verdienen will. Er wird sich vielleicht überlegen, erst einmal ein bestimmtes Niveau an (beruflichen) Qualifikationen zu erwerben. Dafür bieten sich eine Berufsausbildung oder ein Studium an. Im Anschluss daran kann er erneut überlegen, ob seine Fähigkeiten mittlerweile ausreichen, um z. B. als Selbstständiger oder Freiberuflicher tätig zu werden oder ob es ihm Spaß machen würde, ohne ein solches unternehmerisches Risiko zu leben und eine Anstellung zu suchen.
Wäre es jetzt an der Zeit, um über Knechtschaft, Ausbeutung und Entfremdung zu reden? Ich denke nicht. Vergessen wir nicht, dass wir Berufsfreiheit haben und dass sich die Menschen aussuchen können, ob sie lieber auf dem Bau oder im Büro arbeiten wollen. Sie orientieren sich entsprechend ihrer Neigungen und Interessen (und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen) in ihrem (selbst definierten) Umfeld.
Wenn jemand ein gutes Zahlenverständnis besitzt, gern mit anderen Menschen umgeht und einen Bürojob sucht, dann könnte er z. B. Bankkaufmann werden. Das sollte auf Anhieb keinen Konflikt mit seinen fundamentalen Interessen hervorrufen. Ein geborener Handwerker dagegen, der lieber mit seinen Händen arbeitet, wird möglicherweise lieber Schlosser werden und dort seine Erfüllung finden. Würde der Bankkaufmann mit dem Schlösser tauschen müssen, wären wohl beide unglücklich. Manchmal trifft man auf Anhieb leider nicht die richtige Entscheidung. So kenne ich eine gelernte Werbekauffrau, die mittlerweile Friseurin ist. Sie fand keinen Gefallen an ihrem alten Job und ist nun rundum zufrieden.
Nun komme ich zu Marx. Seine Schriften sind ja nun schon etwas älter und eher theoretischer Natur. Meiner Meinung bleibt er mir die Antwort auf einige Fragen schuldig (aber dafür ist schließlich th30 da):
Beispiel 1: Ich mache einen Termin mit einem Kundenberater meiner Bank, um ein Tagesgeldkonto zu eröffnen und einen Riestervertrag abzuschließen. Das Gespräch dauert eine halbe Stunde und als ich die Bank verlasse, ist alles erledigt. Das Gesprächsklima war entspannt und der Berater machte einen guten Job. Er stellte mich zufrieden und ich stellte ihn zufrieden. Außerdem verdiente er noch eine Provision an mir. – Wenn ich jetzt noch einmal die Bank betrete, was soll ich ihm dann sagen hinsichtlich der Entfremdung, die er während der letzten halben Stunde erfahren hat? Hat er durch die Beratung etwas verloren, was ich ihm genommen habe? Oder ist er vielleicht einfach nur froh darüber, einen tollen Job gemacht zu haben?
Beispiel 2: Ich bringe mein Auto zur Inspektion, weil es ein komisches Geräusch von sich gibt. Der Mechaniker schaut sich die Sache an, findet und behebt das Problem und präsentiert mir neben der Rechnung gleich noch eine Erklärung für das, was geschehen ist. Er genießt es, in Sachen Auto ein Experte zu sein und freut sich darüber, wieder einmal ein Problem aus der Welt geschafft zu haben. Darüber hinaus hört er gern mein Lob. – Was soll ich dem Mechaniker sagen? Hey Junge, spürst Du nicht die Entfremdung, die durch Deine Tätigkeit in Dir ausgelöst wird?
Beispiel 3: Ein ungelernter Arbeiter hangelt sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten. Vorletzte Woche säuberte er Farbfässer, letzte Woche jobbt er als Lageraushilfe. Diese Woche hilft er bei einem Entrümpelungsunternehmen aus und nächste Woche wird er irgendwo am Band stehen. – Bei ihm könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass er nicht immer den Sinn seiner Arbeit sieht und darin auch nicht immer Erfüllung findet. Aber derartige berufliche Lebensläufe sind in Deutschland heute längst nicht mehr die Regel. Die Zeit der Tagelöhner ist vorbei.
Heute bleiben die Arbeitnehmer oft jahrelang bei ein und demselben Arbeitgeber. Wenn die Verhältnisse dort immer so schlecht wären, dann wäre auch die Fluktuation größer. Die Rahmenbedingungen sind auch meist recht angenehm. Es ist ja nicht so, dass die Leute von morgens 7 Uhr bis abends 22 Uhr im Laden stehen müssten, am besten noch an 6 Tagen in der Woche. In der Regel wird nur noch ca. 37-40 Stunden lang gearbeitet. Überstunden werden abgefeiert oder ausbezahlt. Nur bei Führungskräften gelten Überstunden meist schon mit dem Gehalt als abgegolten. In vielen Betrieben macht Qualitätsmanagement die Runde: Dabei werden Abläufe optimiert und standardisiert. Die Mitarbeiter entwickeln das oft selbst mit und durchblicken danach besser die Zusammenhänge im Betrieb. Wo bleibt bei alledem die Entfremdung von der Arbeit?
Man kann natürlich argumentieren, dass der Wert eines hergestellten Produkts den Arbeitslohn übersteigt. Aber ist das von Bedeutung? Nehmen wir z. B. eine Filiale von McDonald’s, die bekanntlich mit Franchising betrieben wird. Der Betreiber der Filiale arbeitet nicht nur für sich selbst, sondern gibt einen Teil seines Umsatzes an den Mutterkonzern ab. Ist das eine Form der Entfremdung? Nicht unbedingt. Denn der Pächter bekommt etwas dafür. Anders formuliert kann man sagen, dass er sich von McDonald’s bestimmte Dinge einkauft: das Sortiment, das Logo, das Marketing, den Bekanntheitsgrad, den Einkauf usw. Er macht keinen eigenen Laden unter seinem eigenen Namen auf, wo er für das alles selbst sorgen müsste, sondern er nutzt dafür das Franchising.
So ähnlich könnte man das bei einem Arbeitnehmer auch betrachten. Der Kundenberater bei der Bank könnte theoretisch auch selbstständig sein und Kunden kostenpflichtig beraten. Aber das ist ein anstrengendes Geschäft mit einem gewissen Risiko. Die Bank, die den Kundenberater einstellt, bietet ihm eine komplette Infrastruktur für seine Arbeit, dazu einen großen Kundenstamm und ein festes Gehalt. Dafür erhält er als Kundenberater nicht den Lohn in Höhe seiner Arbeitsleistung, sondern nur den zuvor ausgehandelten Anteil. Es ist sozusagen ein Deal zwischen der Bank, die den Kundenberater benötigt, und dem Kundenberater, der nicht auf eigenen Füßen stehen will.
Schlussendlich sehe ich heute in Deutschland kaum noch Anhaltspunkte, um Marx zu zitieren, wenn es um das Thema Arbeit geht. Das soll nicht heißen, dass alle Arbeitnehmer (und Unternehmer) mit ihrer beruflichen Situation zufrieden sind. Ich will auch nicht bestreiten, dass es eine gewisse Klientel gibt, der es vergleichsweise schlecht geht. Man muss aber auch sehen, dass es heute jedem Sozialhilfeempfänger immer noch deutlich besser geht als der Mehrzahl der Beschäftigten zu der Zeit von Marx. Und das verdanken wir nicht der Abschaffung des Eigentums an Produktionsmitteln, sondern dem Fortschritt und der Arbeitsteilung (bzw. der daraus resultierenden Produktivität), die ja angeblich das Grundübel der (abhängigen) Arbeit und die Ursache der Entfremdung sein soll.
Bei aller Kritik am System: Wir kennen keine Hungersnot mehr in Deutschland und die Menschen werden so alt wie nie zuvor. Kriege sind nur noch Themen für das Kino und das Fernsehen, für Bücher und Erzählungen. Mir ist ein wenig schleierhaft, warum manche Leute unbedingt die nächste Revolution herbeisehnen (sei es nun die Revolution in der Arbeit oder in der Gesellschaft). Wer sagt denn, dass danach alles besser werden würde?
==================================
Im Übrigen habe ich ein Problem mit einem Satz von th30 in Beitrag 3:
"Denn das System diktiert auch zugleich die Art und Weise wie Arbeit organisiert werden muss durch die innere Beschaffenheit des Systems selber."
In meinen Ohren klingt das nämlich so, als sei das System etwas Eigenständiges, ein Wesen mit einem Willen und mit Zielen. Aber das System ist von Menschen geschaffen worden und es wird durch Menschen in Betrieb gehalten. Man könnte auch sagen, das jedes System von seinem ersten bis zum letzten Atemzug von den Menschen abhängig ist, nicht umgekehrt. Ein gutes Beispiel dafür war die Wende in der DDR. Als die Bevölkerung keine Lust mehr auf den DDR-Sozialismus hatte, ging das System zugründe.