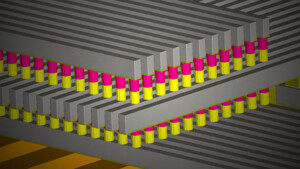"Ist das wirklich ein Problem, dass der Arbeiter das Produkt seiner Arbeit nicht ein Eigen nennen kann? Man könnte sich ja fragen, was er mit seinem Produkt machen würde. In den meisten Fällen würde er es wohl verkaufen, also gegen Geld tauschen. Wenn er nun in einem Beschäftigungsverhältnis steht, kann er sich diesen Aufwand sparen."
Mensch keshkau manchmal glaube ich dass du gar nicht wirklich liest was ich geschrieben habe

Es geht doch die ganze Zeit darum, dass Marx eben das
Beschäftigungsverhältniss, nämlich den Verkauf der Arbeitskraft per Vertrag verurteilt und dass für ihn eben genau da die Entfremdung des Arbeiters vom Produkt beginnt. Versteh das doch bitte einmal. Wenn du das verstehen würdest, dann würdest du nicht mehr diese Beispiele konstruieren, die notwendig ein Beschäftigungsverhältniss als Begründungshilfe beinhalten...so sehr deine Beispiele dann in sich auch schlüssig sein mögen

Und dann weiter: er (der Arbeiter) würde das Produkt selbst verkaufen
aber dann könnte er alleine festsetzen was es ihm wert ist. In einem Beschäftigungsverhältniss ist er losgelöst vom Gebrauchs- und Tauschwert des Produkts, denn den Preis zum Verkauf setzt nicht er sondern sein
Arbeitgeber. Der Arbeiter verdient nicht am Produkt, er wird nur vom Arbeitgeber für die Zeit bezahlt, die er nicht arbeitet (also sich regeneriert) um dann wieder Produkte mit Mehrwert auszustatten. Und vom Mehrwert und vom Gebrauchswert des eigenen Produkts hat der Arbeiter rein gar
nichts.
Ihn (den Arbeiter) kostet es nichts das Produkt per
abstrakter Arbeit (siehe Beiträge weiter oben) auszustatten, weil das automatisch während seiner
konkreten Arbeit passiert.
Aber für den Unternehmer ist das total toll, weil er so vom Arbeiter etwas abschöpft wofür dieser gar nicht entlohnt wird!
Nochmal aus dem Buch "Vernunft und Revolution" vielleicht wirds dann klarer und ich bitte euch (adam und keshkau euch das wenn nötig auch 10x durchzulesen:
"Der Kapitalist bezahlt den Tauschwert der
Ware Arbeitskraft (also den Lohn) und kauft ihren Gebrauchswert, nämlich
die Arbeit.
Der Wert der Arbeitskraft und ihre Verwertung im Arbeitsprozess sind zwei Verschiedene Größen.
Der Kapitalist läßt die von ihm gekaufte Arbeitskraft an der Maschinerie der Produktion sich betätigen.
Der Arbeitsprozess enthält sowohl einen
objektiven als auch einen
subjektiven Faktor: die Produktionsmittel auf der einen Seite und die Arbeitskraft auf der anderen. Die Analyse des Doppelcharakters der Arbeit hat gezeigt, dass der objektive Faktor
keinen neuen Wert erzeugt.
Der Wert der Produktionsmittel erscheint einfach im Produkt wieder.
Anders aber mit dem
subjektiven Faktor des Arbeitsprozesses, also der sich betätigenden Arbeitskraft. Während die Arbeit durch ihre zweckmäßige Form den Wert der Produktionsmittel auf das Produkt
überträgt und
erhält, bildet jedes Moment ihrer Bewegung zusätzlichen Wert,
Neuwert. Die Qualität, den Wert zu erhalten, indem sie neuen Wert
hinzusetzt, ist sozusagen eine "Naturgabe" der Arbeitskraft, die den Arbeiter
nichts kostet aber dem Kapitalisten viel einbringt.
Diese Eigenschaft der abstrakt allgemeinen Arbeit, die sich hinter ihren konkreten Formen verbirgt, hat selbst keinen eigenen Wert, obgleich sie die einzige Quelle neuen Wertes ist. Der Arbeitsvertrag schließt somit Ausbeutung ein"
(Herbert Marcuse, Vernunft und Revolution, S.270 ff. Gesammelte Schriften Bd.4)