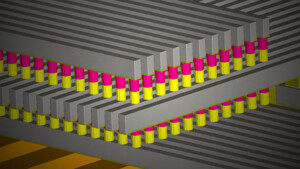In der
Rechtsprechung wurde die Teilnahme an einer Sitzblockade früher als
Nötigung im Sinne des
§ 240 Strafgesetzbuch (
StGB) gewertet, dessen Tatbestand die rechtswidrige Anwendung von
Gewalt (oder Drohung mit einem empfindlichen Übel) voraussetzt mit dem Ziel, eine andere Person zu einer bestimmten Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen. Die alte Rechtsprechung ging davon aus, dass das
Tatbestandsmerkmal der
„Gewalt“ nicht nur durch physischen Zwang, sondern
auch durch psychischen Zwang erfüllt sei. So sei etwa der
Fahrer eines
blockierten Fahrzeugs einem psychischen Zwang ausgesetzt, da er in aller Regel
nicht gewillt sei, die Blockierer zu
überfahren und dadurch zu verletzen oder gar zu töten. Nach dieser Sichtweise machten sich die
Blockierer daher bereits durch ihre
bloße Anwesenheit wegen
Nötigung strafbar (vgl. hierzu u.a.
Bundesgerichtshof [BGH], Urteil vom 8. August 1969 – Az.: 2 StR 171/69).
Diese
Auslegung des
Gewaltbegriffs erklärte das
Bundesverfassungsgericht 1995 für
verfassungswidrig, da die Erweiterung des Begriffs auf psychische Gewalt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts die
Wortlautgrenze des
§ 240 StGB überstreitet und daher gegen das strafrechtliche
Analogieverbot aus Artikel 103 Absatz 2 GG
verstößt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 10. Januar 1995 – Az.: 1 BvR 718/89). Folglich erforderte das Vorliegen von
„Gewalt“ im Sinne des § 240 Absatz 1 StGB seitdem eine
physische Zwangswirkung.