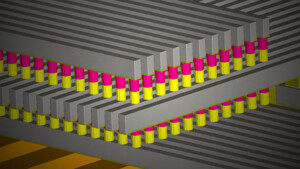Die Argumente sind bekannt, für die Prüfung der Laufzeitverlängerung (die die Betreiber wohl bei Unmöglichkeit nicht auf den Tisch gelegt hätten) hat das Umweltministerium auch nur zehn Tage gebraucht.
Mag sein, dass es jetzt zu spät ist, war es das Ende Februar auch oder fehlte da der Wille?
Führung des Umweltbundesministeriums:
Ministerin: Frau Lemke (Studium der Agrarwissenschaft, Fachrichtung Tierproduktion)
Parl. Staatssekretär: Herr Kühn (Studium der Politikwissenschaft und Soziologe)
Beamteter Staatssekretär: Herr Tidow (Studium der Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Pädagogik)
Sachliche und neutrale Prüfung in drei Tagen? Alles klar.
Der thermische Kraftwerkspark ist bereits ausgedünnt und weiter wird Abschalten beklatscht...
https://www.bundesnetzagentur.de/DE...ugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/start.html
Die Wahrscheinlichkeit von zumindest Teilblackouts im nächsten Winter steigt mit jedem Tag.
Die Reihenfolge bei einem Ersatz von Altanlagen geht so:
Zuerst werden die neuen Anlagen finanziert, errichtet und gehen in den erfolgreichen Regelbetrieb, dann wird die Altanlage außer Betrieb genommen.
Aber vielleicht ist das in der Politikwissenschaft anders.
Nachtrag:
Auf der Homepage des Bundesumweltministeriums steht:
"Ein längerer Betrieb über den 31.12.2022 hinaus könnte allenfalls für etwa 80 Tage durch einen sogenannten Streckbetrieb ermöglicht werden. Das bedeutet, die Atomkraftwerke würden dann im Sommer 2022 weniger Strom produzieren und die Brennelemente langsamer "abgebrannt", um über den 31.12.2022 hinaus im 1. Quartal 2023 noch Strom produzieren zu können. Dies würde den Betriebszyklus des Reaktorkerns verlängern.
Könnten längere Laufzeiten der sich noch am Netz befindenden Atomkraftwerke einen sinnvollen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten?
Nein, jedenfalls keinen relevanten. Denn die hohe Abhängigkeit von Gas aus Russland besteht vor allem im Bereich der Wärmeerzeugung und der Industrie. Hier spielen Atomkraftwerke aber keine Rolle. Im Strombereich decken die drei sich noch am Netz befindlichen AKW Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 mit insgesamt 4300 MW Leistung (brutto) im Durchschnitt circa 30 Terawattstunde (TWh) pro Jahr ab – das sind nur circa 5 Prozent der deutschen Stromproduktion."
Nun stellt sich die Frage, wann wäre der Reststrom hilfreicher? Im warmen Sommer 22, wenn die Sonne scheint oder im kalten Winter 22/23, wenn die Sonne nicht scheint?
Mit 80 Tagen mehr käme man gut bis Mitte März, im Zeitraum vom Jan23 bis Mrz23 wird es um jede gesicherte MWh gehen.
"Das sind nur 5%" in Bezug auf die Versorgungssicherheit, solche Aussagen können m. E. nur Leute treffen, die entweder verblendet oder ahnungslos sind und sämtliche Bodenhaftung verloren haben.