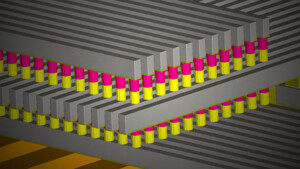Chinas Rohstoffhunger
Rohstoffimportländer werden die höheren Preise zu spüren bekommen - Neue Nachfrage
verdrängt die alte.
Der Krieg um Rohstoffe findet nicht statt
Der Aufstieg Chinas und anderer Schwellenländer treibt die Preise, doch die Märkte passen
sich an
Es ist wohl etabliert, dass alle Länder durch die internationale Arbeitsteilung erhebliche
Wohlfahrtsgewinne erzielen. Sie spezialisieren sich auf die Produktion derjenigen Güter, für
die sie Ausstattungsvorteile bei den Produktionsfaktoren haben. So kann ein Schwellenland
wie China durch die Produktion vor allem arbeitsintensiver Güter sein Wachstum stimulieren.
Es gelang ihm in den letzten 25 Jahren 422 Millionen Menschen aus der Armut (gemessen an
einem Einkommen von unter einem US Dollar pro Tag) herauszuführen. Gleichzeitig haben
die Industrieländer Vorteile, indem sie die arbeitsintensiven Güter der Schwellenländer
preiswert importieren und hochwertige kapitalintensive Konsum- und Investitionsgüter
dorthin exportieren. Dabei sorgt die kräftige wirtschaftliche Expansion in den aufstrebenden
Volkswirtschaften Jahr für Jahr für einen willkommenen zusätzlichen Nachfrageimpuls für
die Exporte der Industrieländer.
Weniger beachtet wird dagegen, welche Auswirkungen die Schwellenländer auf den
Rohstoff- und Faktormärkten haben. So hat die langjährige wirtschaftliche Expansion Chinas
zusammen mit dem kräftigen Bauboom und dem Aufbau der Exportindustrie einen kolossalen
Rohstoffhunger des Landes mit sich gebracht. Seine Anteile an den Weltimporten liegen bei
46 Prozent für Eisenerz, 36 für Baumwolle, 23 Prozent für Kupfererz, 21 Prozent bei Zellstoff
und Papier, 20 Prozent für Gummi, 12 Prozent für Plastik und bei 6,2 Prozent bei Rohöl.
Auch bei Nahrungsmitteln sind die Anteile beachtlich: 40 Prozent bei Soja und 34 Prozent bei
Ölsaaten. Zum Vergleich: Der Anteil Chinas an der Weltproduktion bewegt sich bei 5 Prozent
(Daten für 2005).
Diese Anteile sind in den letzten Jahren kräftig angestiegen. So erhöhte sich etwa der Anteil
der Rohölimporte von Null im Jahr 1993, als China selbst noch genügend Erdöl produzierte,
auf 6 Prozent der Weltimporte im Jahr 2005. Bei einer eigenen Produktion von 3,6 Millionen
Fass (pro Tag) und einem Verbrauch von 6,6 Millionen Fass lag Chinas Importnachfrage
2005 bei 3,6 Millionen Fass; noch im Jahr 2001 hatte diese Überschussnachfrage nur 1,4
Millionen Fass pro Tag ausgemacht. Chinas Anteil am Weltstahlverbrauch nahm von 17
Prozent 1992 auf 31 Prozent 2006 zu.
China reagiert auf diese Situation, indem es sich im Ausland eigene Rohstoffquellen, vor
allem in Afrika und Lateinamerika, erschließt. Ein Teil seiner ausländischen
Direktinvestitionen – es waren 11,3 Milliarden US Dollar im Jahr 2005 - dient diesem Zweck.
Die Rohstoffimporte dürften in Zukunft auch eine Rolle bei der Bestimmung des Außenwerts
des Renminbi spielen, da eine unterbewertete Währung, die den Export erleichtert, auf der
anderen Seite der Medaille die Kaufkraft im Ausland schmälert.
Auf dem Weltmarkt sind mit dem Nachfrageschub nach Energie und Rohstoffen Preiseffekte
verbunden. Beispielsweise stieg der Preis für Stahlschrott, der im Zeitraum 1999-2002 bei
100 US$ pro Tonne lag, durch den chinesischen Bau- und Exportboom auf 250 US$ pro
Tonne im Jahr 2003 an. Für Rohstoffexportländer eröffnen sich damit neue Chancen. Vor
allem ressourcenreiche Länder in Afrika und Südamerika werden durch den Importsog
Vorteile haben. Dagegen werden die Rohstoffimportländer, und zwar sowohl
Entwicklungsländer und Schwellenländer als auch Industrienationen, die höheren
Rohstoffpreise in höheren Kosten zu spüren bekommen. Neue Nachfrage verdrängt alte
Nachfrage. Dieser Effekt wird sich besonders bei Erdöl bemerkbar machen, wo mit einer
Steigerung der Importnachfrage Chinas um das bis zu Zwanzigfache bis 2020 gerechnet wird.
Auch für den Import von Kohle wird eine ähnliche Steigerung erwartet.
Auch bei einer Ressource, für die bisher weltweit noch kein Knappheitspreis etabliert ist, wird
China beachtliche Auswirkungen haben – bei der Erdatmosphäre als Aufnahmemedium von
CO2- Emissionen und anderen Klimagasen. China hat seit 1980 seinen CO2 – Ausstoß
verdoppelt und produzierte 4,5 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr 2004. Dies war mehr als die
EU-25 mit 3,6 Milliarden Tonnen, wenn auch weniger als die USA mit 7 Milliarden Tonnen.
Wenn einmal eine globale institutionelle Regelung gegen die Klimaerwärmung gefunden ist,
wird China den Knappheitspreis für die globale Umweltnutzung entscheidend nach oben
treiben und die derzeitigen Industrieländer zu kräftigen Anpassungen zwingen.
Glücklicherweise verfügt die Weltwirtschaft mit den Märkten über institutionelle Regelungen,
mit denen über die konkurrierende Verwendung von Ressourcen in friedvoller Weise – also
ohne einen Weltkrieg um Rohstoffe – entschieden werden kann. Die Ressource geht zum
besten Wirt. Auch politisch gestaltete langfristige Lieferverträge sind, wie die beiden Ölkrisen
zeigen, auf lange Frist nicht attraktiv. Ferner darf man mit einer erheblichen Elastizität der
Weltwirtschaft rechnen. So erwies sich die von vielen geäußerte Befürchtung, der Eintritt des
reichlich mit Arbeitskräften ausgestatten Chinas müsse auf dem Weltkapitalmarkt zu einer
relativen Verknappung des Kapital führen, als unzutreffend. Die Realzinsen sind verblüffend
niedrig. Und die Anpassung auf den Weltarbeitsmärkten – immerhin ist mit China das
Weltarbeitsangebot um nahezu ein Viertel gestiegen - hat sich zwar nicht ganz schmerzlos,
aber überraschend doch ohne große Verwerfungen in den Industrieländern vollzogen.
Dennoch sind auf einzelnen Rohstoffmärkten in den nächsten Jahren starke Preissteigerungen
nicht auszuschließen, wenn die Schwellenländer ihre zusätzliche Nachfrage entfalten.
Deutschland und die europäische Union sind deshalb gut beraten, diese Effekte vor allem bei
Energie in ihren strategischen Überlegungen für die Zukunft einzuplanen.
http://www.ifw-kiel.de/das-ifw/organisation/siebert/siebert-pdf/hb_02_07.pdf